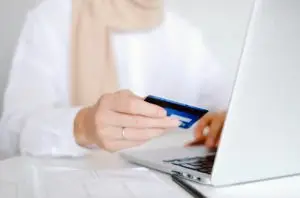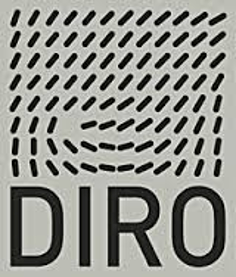Seit 1. 1.2023 ist die neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft. Sie dient als Maßstab für die Festlegung der Höhe des Unterhaltsbedarfs für minderjährige und volljährige Kinder. Die Jugendämter und Gerichte wenden diese Tabelle konsequent an.
Was ist neu?
Auffallend ist eine starke Erhöhung der Unterhaltsbeträge. Damit einher geht jedoch auch eine entsprechende Erhöhung des so genannten Selbstbehaltes. Letzterer gibt an, wie viel einem Unterhaltspflichtigen selbst noch für seinen Lebensunterhalt monatlich zu verbleiben hat. Hintergrund für die Erhöhungen sind die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Insbesondere Wohnkosten und Energiekosten sind geradezu explodiert. Aber auch inflationsbedingte Erhöhungen der Preise für Lebensmittel etc. machen allen Beteiligten zu schaffen.
Durchschnittlich sind die Beträge um gut 10 % erhöht worden. Dies wird zum Teil durch das erhöhte Kindergeld von nunmehr 250 € monatlich abgefedert. In der untersten Einkommensgruppe bei einem Einkommen bis 1900 € netto monatlich sind daher mindestens 312€ für Kinder bis sechs Jahren, 377 € für Kinder bis zwölf Jahren und €463 € für Kinder bis 18 Jahren zu zahlen. Dem Unterhaltspflichtigen sind jedoch monatlich 1370 € zu belassen.
Wer kann das bezahlen?
Wenn man sich vor Augen hält, dass viele Menschen noch nicht einmal ein solches Nettoeinkommen von 1900 € monatlich erreichen, da der Mindestlohn von derzeit zwölf Euro pro Stunde nur zu einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 1520 € führt, wird schnell klar, dass schon der Mindestunterhalt für ein Kind von einem solchen Unterhaltspflichtigen nicht voll geleistet werden kann. Erst recht gilt dies bei mehreren Kindern, so dass zu erwarten steht, dass verstärkt alleinerziehende Elternteile zusätzliche öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen müssen. In Betracht kommt die Beantragung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Jugendamt, Wohngeld und andere Sozialleistungen. Daneben wird von den Gerichten wiederum die Frage geklärt werden müssen, ob ein unterhaltspflichtiger Elternteil nicht neben seinem Vollzeitjob noch einen Nebenjob als Geringverdiener ausüben muss, mit dem sich ein zusätzliches Einkommen von 520 € monatlich im Wege der Pauschalversteuerung erzielen lässt. Diese Frage lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern hängt vom Einsatzbereich, den Arbeitszeiten und anderen Belastungen im Rahmen des eigentlich ausgeübten Berufes ab. Beispielsweise wird dies bei jemand, der im Schichtbetrieb arbeitet und dessen Schichten nicht immer im Voraus gleich geregelt sind, nicht zumutbar sein. Denn wie soll man in einem solchen Fall die Arbeitszeiten für einen Nebenjob planen können?
Fazit: Keine Verbesserung in den meisten Fällen
Im Ergebnis mag es daher sein, dass trotz der Erhöhung der Tabellensätze auf dem Papier tatsächlich nicht mehr Unterhalt gezahlt werden muss als vorher oder sogar weniger. In vielen Fällen ist dem unterhaltsberechtigten Elternteil bzw. den Kindern mit der aktuellen Änderung der Düsseldorfer Tabelle nicht geholfen. Nur bei besser verdienenden Elternteilen wirkt sich die Erhöhung der Tabellensätze spürbar aus.