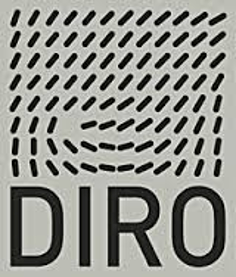Nach einem Todesfall stellen sich oftmals viele Rechtsfragen. Hierzu gehört auch das Problem, ob und welche nahen Angehörigen des Verstorbenen einen sogenannten Pflichtteilsanspruch haben.
Dies ist der Fall, wenn der Verstorbene seinen Ehegatten, seine Eltern oder Kinder von seinem gesetzlichen Erbrecht ausgeschlossen hat. Andere Verwandte, z.B. auch Geschwister haben kein solches Pflichtteilsrecht.
Der Höhe nach liegt dieser Pflichtteil bei der Hälfte dessen, was man ohne Enterbung als gesetzlichen Erbteil erhalten hätte. Aber wie erfährt man, wie sich dieser Anteil errechnet und von wem man diesen einfordern kann? Hierzu sieht das Gesetz vor, dass das Nachlassgericht eine dort hinterlegte letztwillige Verfügung (also Testament oder Erbvertrag) nach Bekanntwerden des Todes an die nahen Angehörigen in Kopie übersendet. Wenn also das Testament zu Hause beim Verstorbenen liegt, muss dafür gesorgt werden, dass es dem Gericht vorgelegt wird. Sodann kann der übergangene Erbe von dem oder den tatsächlichen Erben Auskunft über den Bestand des Vermögens am Todestag verlangen. Diese Auskunft muss umfassend und geordnet sein. Dazu gehört auf der einen Seite eine Einzelaufstellung aller Vermögensgegenstände, auf der anderen Seite eine Auflistung aller etwaigen Schulden einschliesslich der Begräbniskosten. Die Differenz bildet die Erbmasse, aus der dann der Pflichtteilsberechtigte seine Quote beanspruchen kann.
Ein Anspruch auf Vorlage von Belegen aus der Aufstellung zwecks Kontrolle besteht nicht. Etwas anderes gilt dann, wenn nur so der Wert eines Gegenstandes ermittelt werden kann. So kann man z.B. bei Grundstücken, Gebäuden, Schmuck etc. Unterlagen einfordern. Hier muss dann der Erbe zunächst alle Angaben zu wertbildenden Faktoren (z.B. Grösse, Lage, Alter etc.) machen. Auf Verlangen ist vom Erben auch ein Gutachten einzuholen, wenn man sich nicht über den Wert einigen kann oder nach Kenntnis der vorhandenen Unterlagen eine Bewertung nicht sicher möglich ist. Das Recht zur Auswahl des Gutachters liegt beim Erben, der auch die Kosten hierfür aus dem Nachlass tragen muss.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten Pflichtteilergänzungsansprüche.
Hierbei müssen Schenkungen des Verstorbenen in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod dem Nachlass hinzugezählt werden. Wegen einer Gesetzesänderung zum 1.1.2010 werden aber für jedes Jahr, das seit der Schenkung vergangen ist, 10% vom Wert abgezogen. Ein Auto, das z.B. 3 Jahre vor dem Tod verschenkt wurde, kommt daher nur noch mit 70% des Wertes in Ansatz.
Allerdings besteht weder bei den Pflichtteilsansprüchen noch Ergänzungsansprüchen hierzu eine Teilhabe an den jeweiligen Gegenständen selbst, sondern immer nur ein Anspruch auf den Gegenwert in Geld.
Unbedingt zu beachten ist, dass Ansprüche auf den Pflichtteil nebst Ergänzungen hierzu innerhalb von drei Jahren verjähren, gerechnet zum Ende des Jahres, in dem der Todesfall eingetreten ist und man hiervon Kenntnis erlangt